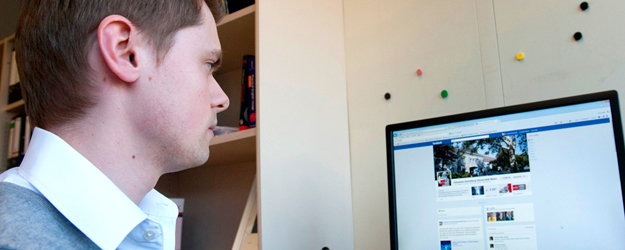23. April 2012
Ob Partyfotos, Beziehungsstatus oder sexuelle Orientierung – Selbstoffenbarung ist im Social Web an der Tagesordnung und User unterscheiden dabei kaum zwischen guten Freunden, Bekannten oder Arbeitskollegen. Dadurch geht die Privatsphäre verloren. Am Institut für Publizistik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) beschäftigt sich Juniorprof. Dr. Leonard Reinecke mit der Frage, wie Nutzer von sozialen Netzwerkplattformen wie Facebook mit Selbstoffenbarung und dem Schutz der Privatsphäre umgehen.
Wenn man das Büro von Juniorprof. Dr. Leonard Reinecke im fünften Stock betritt, fallen zuerst die milchigen Fensterscheiben auf, die noch auf den Frühjahrsputz warten. "Aber die Aussicht ist trotzdem toll", findet Reinecke. Er ist noch nicht lange in Mainz, seit Februar 2012 ist der Medienpsychologe Juniorprofessor mit Schwerpunkt Online-Kommunikation am Institut für Publizistik der JGU. Bereitwillig schildert er seine Sicht auf aktuelle Entwicklungen des Social Web und die Zukunft der Privatsphäre in Zeiten der allgegenwärtigen Verfügbarkeit privater Informationen.
Versuch, soziale Bedürfnisse zu erfüllen
Reineckes Forschung trifft den Zeitgeist: Social Media erfreuen sich sehr großer Beliebtheit. Allein bei Facebook sind 800 Millionen Menschen weltweit registriert. Ein wichtiger Motivator für die Kommunikation im Social Web sind soziale Beweggründe, wie zum Beispiel der Aufbau von sozialen Bindungen. "Man will Freunde und Bekannte auf dem Laufenden halten, seine Einstellungen und Meinungen kundtun", weiß Reinecke. Der ständige Austausch erzeuge ein Gefühl von Verbundenheit. Außerdem halte man Kontakt zu wichtigen Leuten, auch wenn diese sehr weit weg wohnen, und erreiche innerhalb kürzester Zeit sehr viele Menschen. "Nutzer haben im Social Web einen enorm hohen Wirkungsgrad bei sehr geringem Aufwand", weist Reinecke auf einen Vorzug der sozialen Netzwerke hin.
Auch das Spiel mit der eigenen Identität ist ein Faktor, der den Reiz von Social Media ausmacht. Das Social Web ist zu einer Bühne, einem Ort der Selbstdarstellung geworden. Man teilt öffentlich alles mit – dass es einem gerade super geht wegen des tollen Wetters oder dass man einen Kater von der letzten Party hat, weil man zu viel Gerstensaft genossen hat. Die Preisgabe von privaten – teilweise auch sehr intimen – Informationen hat die Privatsphäre im Social Web stark verändert. Privates wird öffentlich, der Mensch transparenter. Als Mitarbeiter im DFG-Forschungsprojekt "Sozialisation im Social Web" hat Reinecke mit Kollegen an der Universität Hamburg untersucht, warum User im Social Web so vieles von sich offenbaren.
Das Belohnungsprinzip
"Je mehr ich von mir preisgebe, desto mehr profitiere ich", hat Reinecke herausgefunden. Das bedeutet im Klartext: Wer im Social Web etwas postet, wird 'belohnt' durch Feedback und Kommentare, je mehr man postet, desto größer ist demnach auch die Resonanz. Das treibt zur Interaktion an, schränkt aber die Privatsphäre ein.
Man muss sich die soziale Interaktion quasi erkaufen mit der Restriktion der Privatsphäre. Häufig sind die User sich dessen nicht bewusst. "Im Social Web herrscht ein trügerischer Eindruck von Intimität", erklärt Reinecke. Man sei ja vorrangig umgeben von Leuten, die man kenne. "So entsteht eine Illusion der Privatsphäre, die auf den zweiten Blick aber häufig nicht den Tatsachen entspricht."
Illusion der Privatsphäre
Normalerweise habe man Sozialbeziehungen mit einem unterschiedlichen Gehalt an Intensität und Intimität – die Erbtante, der beste Freund oder der unliebsame Nachbar werden verschieden behandelt, das kann man leicht trennen. Im Social Web jedoch kommt es zum Zusammenbruch solcher sozialer Kontexte, da sich dort alle Sozialgruppen vermischen. Es werden alle gleich behandelt. "Die User posten zwar für ein intendiertes Publikum, aber alle Facebook-Freunde können die Einträge lesen – der Arbeitskollege oder der flüchtige Bekannte, dem ich normalerweise nicht alle meine Befindlichkeiten kundtue, mit eingeschlossen", erläutert Reinecke und fasst zusammen: "Die privaten Informationen sind dann einem sehr großen und schwer zu überblickenden Personenkreis zugänglich und können unter Umständen zu unerwarteten Nebenwirkungen führen."
Es gibt zwar Einstellungen, mit denen man seine Freunde gruppieren und dann Informationen nur für bestimmte Gruppen sichtbar machen kann, aber den Aufwand scheuten viele. Und die Folgen des Unterwegsseins im Social Web entzögen sich häufig dem Bewusstsein der Nutzer: Zum Beispiel, dass man soziale Netzwerke mit seinen privaten Daten 'bezahle'; die Betreiber werten diese aus und platzieren dann gezielt Werbung auf der eigenen Seite. "Facebook ist sehr um den Anschein der Transparenz und Userfreundlichkeit bemüht, der interne Umgang mit den privaten Daten der User ist aber nur schwer nachvollziehbar", kritisiert Reinecke.
In zahlreichen Studien gibt zwar die Mehrheit der Nutzer an, dass ihnen Privatsphäre wichtig sei, dies führt aber nicht zwangsläufig zu einem vorsichtigen Umgang mit Selbstoffenbarung und privaten Informationen. Die User posten also weiterhin laszive Bikinifotos und Partybilder – unter anderem auch sichtbar für den flüchtigen Bekannten oder die internetaffine Oma. Reinecke nennt diesen Widerspruch ein 'privacy paradox'. Diesem und weiteren Phänomenen im Schnittbereich von Social Media und Privatsphäre widmet sich das kürzlich von ihm und seiner Kollegin Sabine Trepte (Universität Hamburg) herausgegebene Buch Privacy Online, in dem eine Reihe internationaler Forscherinnen und Forscher ihre Sicht auf Privatsphäre im Social Web darstellt.
Fluch oder Segen?
Natürlich hat Reinecke auch einen Facebook-Account. Großen Drang zur Selbstoffenbarung hat er jedoch nicht. "Ich bin ein eher langweiliger Facebook-User", gibt er schmunzelnd zu. Er nutze Facebook eher berufsbedingt, tausche sich mit Kollegen aus.
Auf die Frage, ob Social Media Fluch oder Segen seien, antwortet er: "Eher Segen als Fluch. Die Vorteile liegen klar im Vordergrund. Soziale Medien ermöglichen Formen der Interaktion, die vorher schlichtweg nicht möglich waren." Trotzdem solle man aber auch kritisch sein, fügt er hinzu. "Man muss natürlich weiterhin die Entwicklungen im Auge behalten und die persönlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen der Nutzung hinterfragen." Und vielleicht ein wenig nachdenken, bevor man das nächste Mal ein Bikinifoto postet – der Abteilungsleiter könnte sonst Feedback geben.