 PHYSIK
PHYSIKStrontium strahlt im digitalen Klassenzimmer
Mit Virtual-Reality-Experimenten beschreiten William Lindlahr und sein Team vom Institut für Physik an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) neue Wege für den Schulunterricht. Versuche, die in der Realität zu gefährlich, aufwendig oder teuer wären, bereiten sie als 3-D-Simulation auf. Das innovative Konzept wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, doch es könnte noch einige Sponsoren mehr vertragen.
 UNIVERSITÄTSMEDIZIN
UNIVERSITÄTSMEDIZINEine Revolution auf dem Feld der Immunabwehr
Es geht um einen neu entdeckten Zelltyp, der ein neues Forschungsfeld öffnet: Die ILCs oder "innate lymphoid cells" sind zentraler Baustein des angeborenen menschlichen Immunsystems, dessen genaue Funktion noch viele Fragen aufwirft. Dr. Georg Gasteiger und sein Team begeben sich am Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene der Universitätsmedizin Mainz auf die Suche nach Antworten.
 PUBLIZISTIK
PUBLIZISTIKHarsche Töne am Stammtisch 2.0
Die Frage, welche Nachrichten im Internet gelesen und welche ignoriert werden, beschäftigt die Kommunikationswissenschaft schon länger. Aber wie steht es um die Diskussionen, die online zu solchen Meldungen geführt werden? Mit dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekt "Vom Nachrichtenwert zum Diskussionswert" suchen Marc Ziegele und Prof. Dr. Oliver Quiring vom Institut für Publizistik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) nach Antworten.
 JOHANNES GUTENBERG-STIFTUNGSPROFESSUR
JOHANNES GUTENBERG-STIFTUNGSPROFESSURSieben Formen des Vergessens
Das Finale ihrer Vorlesungsreihe um die Konstruktion von Erinnerungshorizonten widmeten Aleida und Jan Assmann dem Vergessen. Zuvor hatten die Inhaber der 16. Johannes Gutenberg-Stiftungsprofessur viel vom Erinnern gesprochen. Am zehnten Abend wandte sich Aleida Assmann im größten Hörsaal der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) den sieben Formen des Vergessens zu.
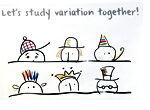 SOCIOLINGUISTICS AND MULTILINGUALISM
SOCIOLINGUISTICS AND MULTILINGUALISMEin Studium an vier Universitäten
Studieren in Litauen und Deutschland und zusätzlich in Schweden oder Estland: Das ist mit dem internationalen Masterstudiengang "Sociolinguistics and Multilingualism" – oder kurz SoMu – möglich. Universitäten aller vier Länder kooperieren, um einen Einblick in die vielfältige Sprachlandschaft, die Gesellschaft und die Geschichte des Ostseeraums zu vermitteln. Prof. Dr. Anneli Sarhimaa vom Forschungs- und Lehrbereich Sprachen Nordeuropas und des Baltikums der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) hat diesen ungewöhnlichen Studiengang mit ins Leben gerufen.
 EVOLUTIONSBIOLOGIE
EVOLUTIONSBIOLOGIEVom Parasiten zum Puppenspieler
Ein Parasit manipuliert seinen Wirt: Wenn der Bandwurm Anomotaenia brevis sich in Ameisen einnistet, verändert sich nicht nur deren Aussehen, sondern ihr gesamtes Verhalten. Sara Beros, Doktorandin am Institut für Zoologie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU), untersucht dieses Wechselspiel seit Jahren.
 CAREER SERVICE
CAREER SERVICEEs geht um mehr als nur um Karriere
Der Career Service der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) begleitet Studierende auf ihrem Weg in Richtung Beruf. Ein vierköpfiges Team berät ganz individuell und organisiert verschiedenste Veranstaltungen von der Jobmesse über Workshops bis hin zur großen Frühjahrs- und Herbstuniversität. Und es bündelt all das, was der Campus sonst noch an Beratungsangeboten bereithält.
 CAMPUS MAINZ E.V.
CAMPUS MAINZ E.V.Buntes Lernen ganz ohne Credits
Die Kulturkurse des studentischen Vereins Campus Mainz e.V. sind gerade erst gestartet und schon mausern sie sich zu einem Riesenerfolg. Zur Premiere im Wintersemester fanden 14 Kurse statt, im aktuellen Sommersemester sind es bereits 40. Die Palette ist bunt: Gitarrespielen, Business English und kreatives Schreiben stehen auf dem Programm, aber auch exotische Fächer wie Gebärdensprache, Quilten oder persische Kalligrafie.
 JOHANNES GUTENBERG-STIFTUNGSPROFESSUR
JOHANNES GUTENBERG-STIFTUNGSPROFESSURVieles bewegt sich im Gehirn
Mit Prof. Dr. Hannah Monyer begrüßen Aleida und Jan Assmann als Inhaber der Johannes Gutenberg-Stiftungsprofessur 2015 eine der weltweit führenden Neurobiologinnen zur Vorlesungsreihe "Erinnern und Vergessen – Zur Konstruktion von Vergangenheitshorizonten". Im größten Hörsaal der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) beleuchtet die Medizinerin, wie das Gedächtnis arbeitet, was genau im Gehirn passiert.
 GUTENBERG-ALUMNI
GUTENBERG-ALUMNIIm Musik-Neubau hätte er gern auch studiert
Er ist ein erfolgreicher Filmkomponist: Chris Bremus hat an der Hochschule für Musik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu seiner Karriere getan. Nun kehrt er nach Jahren für ein Gespräch auf den Campus zurück. Der 37-Jährige erzählt von seinem Studium, von Filmen, Werbesports und vom großen Glück.
